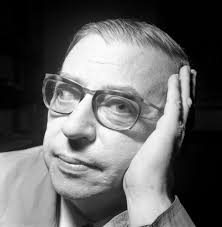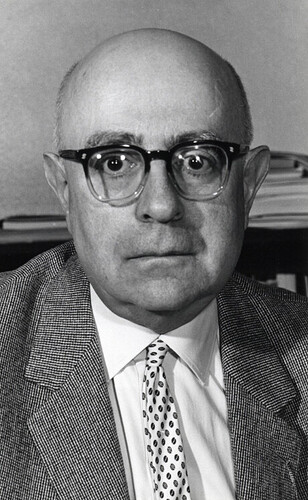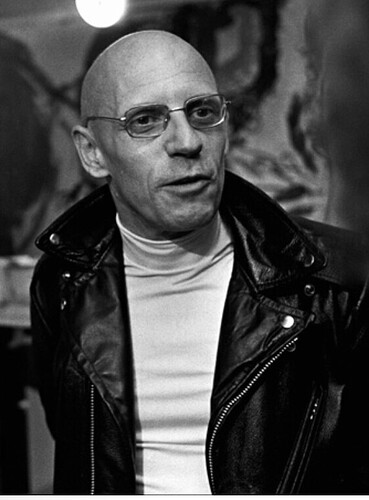Verstehe ich gut. Ich musste mich gestern auch erst wieder einlesend erinnern - ist schließlich 35 Jahre her, dass ich das gelesen habe. Und aus mir ist halt kein Philosoph, sondern ein Zimmermeister geworden.
Vorab mein Versuch einer sinngemäßen Übersetzung des Zitates (wem das reicht, der kann sich meine Versuche, den Hintergrund zu erläutern, dann sparen ![]() ):
):
Kultur und Barbarei bilden einen Gegensatz, der nach dem Verständnis der Dialektik (zwei Seiten ein- und derselben Medaille) untrennbar zusammen gehört. Eine kritische Auseinandersetzung mit Kultur muss sich also immer auch mit ihrem untrennbaren Gegenspieler -der Barbarei- auseinandersetzen.
Die Barbarei wurde mit Auschwitz auf eine neue Stufe gehoben; also ist jede kulturelle Handlung an dieser neuen Stufe zu messen: so ist „ein Gedicht nach Auschwitz barbarisch“.
Der letzte Teil der Aussage „und das frisst auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.“ ist auch für mich nicht eindeutig und deshalb schwerer zu übersetzen. Mein Verständnis ist:
Die „Erkenntnis“ ist eine Kategorie der logischen Philosophie und wird (dialektisch ![]() ) der „Dichtung“ (welche zu den schönen Künsten zählt) gegenübergestellt. Das Barbarische (symbolisiert durch Auschwitz) frisst zugleich die Dichtung wie die Erkenntnis an: Auschwitz stellt sowohl der Philosophie als auch die schönen Künste im Frage - beides wird von der Barbarei „angefressen“.
) der „Dichtung“ (welche zu den schönen Künsten zählt) gegenübergestellt. Das Barbarische (symbolisiert durch Auschwitz) frisst zugleich die Dichtung wie die Erkenntnis an: Auschwitz stellt sowohl der Philosophie als auch die schönen Künste im Frage - beides wird von der Barbarei „angefressen“.
Das ist meine persönliche Interpretation, die eines Bauarbeiters. Falls ich falsch liege, seht mir das nach.
Hope, it helps a little.
Die Bedeutung der Aussage vor ihrem historischen Hintergrund hat @jep schon gut beschrieben. Ich finde es wichtig, sich noch einmal vorzustellen, dass die Befreiung der KZs gerade erst 4 Jahre her war. Viele Trümmer in den Städten waren noch nicht weggeräumt. Viele Intellektuelle (nicht nur) standen fassungslos vor der Frage: Wie konnte uns das passieren - dem Volk von Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven - dem Volk von Goethe, Hesse, Zweig, Büchner, Mann - dem Volk von Luther, Hegel, Feuerbach, Kant, Marx, Nietzsche?
Wie konnten wir zulassen, das so etwas geschieht - die Massenvernichtung von Menschen mit den Mitteln der industriellen Produktion, Massenmord am Fließband, europaweit geplant und logistisch bis in kleinste ausgearbeitet.
Adornos Aussage war (zu dem Zeitpunkt 1949) seine vermeintliche Bankrotterklärung der aufklärerischen Hoffnung, dass Bildung, Geist, Kultur und Vernunft den Menschen aus der Finsternis des Mittelalters in die blühende Zukunft der Aufklärung führen würde, nun befähigt, „in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten“. Ihr lag eine generelle Skepsis ggü. einem möglich positiven Einfluss der modernen Kultur zugrunde.
In ihrem wichtigsten Standardwerk „Dialektik der Aufklärung“ von 1944 (während das Kriegsgrauen noch wütete) thematisieren die beiden Philosophen Adorno und Horkheimer genau diesen Zusammenhang zwischen Aufklärung und Barbarei: Sie beschreiben die Kultur auf ihrem Höchststand von Zivilisation und Aufklärung, welche -in ihrem Zenit angekommen- in die Barbarei und Totalitarismus umschlägt. Eines der spannendsten Bücher, das ich je verschlungen habe - seine Aussagen zur industriellen Massenkultur waren bahnbrechend. (Neil Postmans „Wir amüsieren uns zu Tode“ ist -50 Jahre später- dagegen seichtes lauwarmes Geplätscher.)
@alex hatte beim Lesen sicher seine helle Freude ![]() bei der Lektüre des 4. Kapitels „Kulturindustrie - Aufklärung als Massenbetrug“: Kultur ist in der industriellen Massenproduktion nur noch„Ware“ der Mensch verkümmert zum Konsumenten. Das Ziel der Kulturindustrie ist – wie in jedem Industriezweig – allein ökonomischer Art. Profitmaximierung ist das erste und wichtigste Kriterium für die Qualität von Massenkultur.
bei der Lektüre des 4. Kapitels „Kulturindustrie - Aufklärung als Massenbetrug“: Kultur ist in der industriellen Massenproduktion nur noch„Ware“ der Mensch verkümmert zum Konsumenten. Das Ziel der Kulturindustrie ist – wie in jedem Industriezweig – allein ökonomischer Art. Profitmaximierung ist das erste und wichtigste Kriterium für die Qualität von Massenkultur.
(Ach, ich blättere und blättere: Würde am liebsten jeden Abschnitt wiedergeben… ![]() großartige Denker einer längst vergangenen Zeit. Kaum vorstellbar, dass ein Adorno und ein Precht vermeintlich derselben Disziplin (Philosophie) angehören und in derselben Sprache denken. Aber Precht ist nur ein weiterer Beleg für die These der „Dialektik der Aufklärung“: Es wird kulturell produziert, was sich verkauft. Hinten raus kommt ein Precht, der wie ein Filmstar aussieht und dessen intellektueller Horizont den Schwarzeneggers nur unwesentlich überschreitet - wenn überhaupt. Aber: mega-erfolgreich. Und was sich verkauft, ist richtig.)
großartige Denker einer längst vergangenen Zeit. Kaum vorstellbar, dass ein Adorno und ein Precht vermeintlich derselben Disziplin (Philosophie) angehören und in derselben Sprache denken. Aber Precht ist nur ein weiterer Beleg für die These der „Dialektik der Aufklärung“: Es wird kulturell produziert, was sich verkauft. Hinten raus kommt ein Precht, der wie ein Filmstar aussieht und dessen intellektueller Horizont den Schwarzeneggers nur unwesentlich überschreitet - wenn überhaupt. Aber: mega-erfolgreich. Und was sich verkauft, ist richtig.)
Das Wichtigste an der gesamten Thematik ist aber meiner bescheidenen Meinung nach:
Weder Horkheimer noch Adorno waren resignierte Pessimisten - im Gegenteil. Skeptisch - ja. Aber nicht resignativ.
Auch wenn die Rezeption im folgenden dies häufig unterstellte - Jürgen Habermas (Schüler Adornos) etwa: „Wie können die beiden Aufklärer, die sie immer noch sind, den vernünftigen Gehalt der kulturellen Moderne so unterschätzen, daß sie in allem nur eine Legierung von Vernunft und Herrschaft, Macht und Geltung wahrnehmen?“
Ihre eigentliche Intention beschreiben die Väter der Frankfurter Schule Wikipedia zufolge so:
„Bei aller Radikalität machen sie nicht die „Liquidation von Aufklärung zu ihrer eigensten Sache“.Die an der Aufklärung geübte Kritik verwirft keineswegs deren Idee, sondern will „einen positiven Begriff von ihr vorbereiten, der sie aus ihrer Verstrickung in blinder Herrschaft löst“.
Vor diesem Hintergrund verstehe ich das Diktum „nach Auschwitz sind Gedichte barbarisch“ im doppelten Sinne dialektisch: Kultur (am Beispiel Poesie) kann aufklärerisch sein, wenn sie sich ihres immanenten Potentials zur Barbarei bewusst ist. Kultur kann zur Barbarei werden, wenn sie ihre aufklärerischen Wurzeln verlässt und vergisst.
Ihr wohnt das dialektische Potential zu beidem inne.
Ich habe das Zitat nie als eine endgültige Absage an die Möglichkeiten von Kultur und Aufklärung verstanden, sondern als Warnung vor den Folgen ihres Scheiterns.
Dies ist aber wahrscheinlich nur im Kontext der „Dialektik der Aufklärung“ möglich. Isoliert und losgelöst aus ihrem philosophischen Zusammenhang, kann die Aussage natürlich wie eine resignative Kapitulationserklärung von Kultur und Aufklärung ggü. der Barbarei (miß-)verstanden werden.
Anmerkung:
Der rumänisch-französische Dichter Paul Celan (der auf Deutsch schrieb) verfasste in den letzten beiden Kriegsjahren (als die Verbrennungsöfen in Auschwitz rund um die Uhr brannten) seine berühmte„Todesfuge“ - das inzwischen wohl berühmteste Gedicht über die Judenvernichtung der Nazis. Es wurde zum Leitmotiv der breiten Kritik an Adornos ebenso berühmten Diktum über Gedichte nach Auschwitz. Viele berühmte Dichter sowohl aus der Zeit als auch in den Nachkriegsjahren opponierten vehement gegen Adorno.
Celan selbst erklärte 1958 zur Macht der Sprache:
„Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: die Sprache. Sie, die Sprache blieb unverloren, ja, trotz allem.“
Als Adorno sein (vermeintliches) Verdikt später zurücknahm, geschah dies auch „unter dem Eindruck vor allem der Holocaust-Lyrik Celans“.